Christian, das Stück „Take Five“ von Dave Brubeck bzw. Paul Desmond, besser gesagt ein kurzes Sample daraus, tauchte in den vergangen Jahren immer wieder in der Clubmusik auf. Zunächst basierte der Dancefloor-Hit „Rose Rouge“ von St. Germain darauf, später der Track „Chocopop Jazz“ von Cesar Maravillas sowie der gleichnamige Track von dir. Wussten Brubeck und seine Musiker, dass ihr Stück in der elektronischen Musik weiterlebt?
Christian Prommer: Ich glaube schon. Als „Rose Rouge“ rauskam war Brubeck ja noch nicht so alt, er wird das vermutlich mitbekommen haben. Es ist natürlich auch ein Piano-Motiv, das so in unser Vokabular eingegangen ist, dass man es auch ohne rechtes Wissen zitiert.
St. Germain hat das damals clever gemacht, er hat es in ein anderes Metrum transportiert und aus dem Fünfer- einen Vierertakt gemacht. Er hat für seinen Track ein richtiges Sample benutzt, ich dagegen habe es nachgespielt.
Ach so?
Prommer: Ja, ich fand das Edit, welches Cesar Maravillas von „Take Five“ gemacht hat, perfekt. Und das habe ich dann gecovert, in dem ich alles neu eingespielt habe. Ich habe quasi die Kopie vom Original kopiert.
Hat es für dich eine besondere Bedeutung, dass jemand wie Brubeck im Techno weiterlebt?
Prommer: Auf jeden Fall. Für mich ist eine der großen Motivationen das Dekontextualisieren von Musik. Unser Leben ist ja eigentlich ein einziges Verändern des Kontexts. Und so etwas ist natürlich ein Paradebeispiel: Du nimmst etwas, was in den 50er Jahren aufgenommen wurde und kreierst daraus mit der heutigen Technologie etwas Neues.
Für mich ist es auch ganz wichtig, wieder zurück zu diesen Wurzeln zu gehen. Es gibt immer wieder Phasen, in denen ich die alten Platten rausziehe, auf denen ich dann immer wieder auch neue Sachen entdecke. Zum Beispiel die B-Seite, die man immer ignoriert hat.
Es geht überhaupt nicht um die Bassdrum.
Unter deinen allerersten Produktionen findet man auch eine Eurodance-Version von „Dream a little dream of me“ von 1995. War das bereits das Interesse am Dekontextualisieren?
Prommer: Ach, das ist so weit her, da würde ich sagen, das hatte noch nichts mit mir als Musiker zu tun. Das war dieser Sturm und Drang, man probiert alles mal aus. Mein damaliger Partner Alex Lacher und ich, wir konnten noch nichts schreiben, also haben wir uns etwas gesucht, was quasi im Tempo gepasst hat und sich übersetzen ließ.
Ich hatte damals im Münchner „Parkcafé“ so einen kleinen Raum unterm Dach, dort standen ein paar Geräte, an denen ich viel herumexperimentiert habe. Und über diese – zum Teil etwas schwachsinnigen – Projekte habe ich mich dort auch selbst gefunden. Das war eine gute Zeit.
Hast du mit elektronischer Musik angefangen?
Prommer: Nein, ich hab vorher schon viel gespielt, Rock- und Fusion-Platten gemacht, aber eher auf lokaler Ebene.
Du hast in einem Interview erzählt, dass du in einer sehr musikalischen Nachbarschaft aufgewachsen bist…
Prommer: Bei uns auf dem Gymnasium in Gräfelfing, einem Vorort von München, war Musikmachen cool. Es gab wahnsinnig viele Musiker, zwei Komponistensöhne, viele Bands, auf dem Faschingsball hat eine Fusion-Band gespielt – und wir sind abends nicht in die Disco gegangen sondern in die „Philharmonie“, so hieß der Jazz-Club, wo wir uns krasse Bands angeguckt haben. Das war alles sehr inspirierend, ein tolles Umfeld. Viele meiner Mitschüler machen heute noch Musik.
Kam deine Hinwendung zur Musik im Elternhaus gut an?
Prommer: Ja, mehr oder weniger. Man hat das natürlich so balanciert mit den schulischen Leistungen (lacht). Aber meine Eltern haben das auf jeden Fall unterstützt. Vor allem meine Mutter war ganz begeistert. Ist ja auch ganz praktisch, wenn du einen Sohn hast, der Teenager ist und trommelt. Der sitzt dann zuhause und übt, das kann man nicht überhören – du weißt also immer, wo er ist.
Und deine Eltern waren zuversichtlich, dass du Geld damit verdienen würdest?
Prommer: Nein, das glauben meine Eltern ja bis heute nicht, dass ich damit Geld verdienen kann. (lacht) Für mich war aber schon früh relativ klar, dass das Musikmachen alternativlos ist.
Anfangs hatte ich als Schlagzeuger gut zu tun, was mich dann aber ’94/’95 wahnsinnig gelangweilt hat. Da war es dann für mich eine glückliche Fügung, dass zu der Zeit das Label Compost entstand, dass ich die Leute dort kennen gelernt habe und auf einmal so eine Experimentierwiese gefunden habe. Und dann ging es ja mit Fauna Flash und Trüby Trio richtig los, mit Auflegen, Produzieren, Auftritten…

© PR
Hattest du als Schlagzeuger anfangs Berührungsängste, wenn es um elektronische Drums ging?
Prommer: Nein, nie. Ich fand das total faszinierend.Ich hab auch immer Elektronik in meinem Schlagzeug gehabt, ich hab mir auch gleich den ersten Commodore-Computer mit Soundkarte geholt. Mein Vater ist Ingenieur, Technologie war bei uns zuhause immer ein Thema. Ich habe die Drum-Computer-Thematik immer als Bereicherung und nicht als Bedrohung empfunden.Dieses „Das haben wir noch nie so gemacht“ – dafür bin ich der falsche Typ.
Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob der Computer gerade Beats macht, oder der Mensch mit ein paar Millisekunden Verzögerung.
Prommer: Ich denke, der Grid, das Raster, was im Computer herrscht, gibt vielen Musikern eine Sicherheit. Da wird niemand sagen, die Drums sind schlecht, weil sie quantisiert sind, sondern man freut sich darüber, dass es ‚tight‘ ist. Das ist halt Nummer sicher.
Ich persönlich verstehe das Musikmachen eher als Zwischenräume finden. Die Magie passiert ja nicht auf den Downbeats…
…also nicht auf den geraden Schlägen der Bassdrum.
Prommer: Ich finde es bei Clubmusik wahnsinnig befreiend, dass diese Bassdrum einfach da ist. Die muss ich gar nicht mehr beachten, sondern ich kann mich um alles andere kümmern. Die Räume dazwischen machen die Magie aus. Das ist ja oft das große Missverständnis in Bezug auf Clubmusik: Es geht überhaupt nicht um die Bassdrum.
Das ist genauso wie die verzerrte Gitarre im Rock, mit der muss man in dieser Musik klarkommen. Interessant wird es erst durch das, was drumherum passiert.
Du siehst für dich also genügend Freiraum, auch wenn die Bassdrum stets im gleichen Tempo schlägt.
Prommer: Ja, total. In jeder Musik gibt es einen Puls. Beim Orchester ist das der Dirigent, wenn die Musiker ihm nicht folgen, dann funktioniert es nicht.
In der Clubmusik gibt die Bassdrum den Rhythmus vor – das ist befreiend. Und wir erleben ja immer wieder, was für verrückte Musik damit gemacht wird, die dann aber auch funktioniert. Das Interessante an Clubmusik ist natürlich, dass wahnsinnig viele Schlüsselreize darin sind, es ist manchmal sehr funktional, du kennst die Dramaturgie, die erfordert gewisse Gesetzmäßigkeiten… Im selben Moment kannst du diese Gesetzmäßigkeiten aber auch infrage stellen und den Kontext verändern – weil du durch dieses Rhythmuskonstrukt eine Sicherheit hast. Es gibt beides: einerseits Produzenten, sie sehr frei arbeiten, andererseits gibt es auch Musik, die stark formatiert und trotzdem echt gut ist.
Wo ist da dein Projekt „Drumlesson“ anzusiedeln?
Prommer: Das war die Idee, Clubgesetze auf live gespielte Musik anzuwenden. Ich wollte mit den Musikern, die alle sehr gut sind, eine Musik machen, die eben nicht per se virtuos ist, es geht vielmehr um das Repetetive. Dass du einfach einen Moment spielst wie einen Loop, ohne ihn zu verändern.
Welche Rolle spielt denn das Metronom bei „Drumlesson“-Aufnahmen? Werden die Stücke nachträglich von rhythmischen Unsauberkeiten gereinigt?
Prommer: Wir haben das mit einem „Click-Track“ im Ohr (Metronom) aufgenommen. Aber nachträglich muss da nichts gerade gemacht werden, die Jungs spielen ja so gut, das ist nicht notwendig.
Außerdem ist ein Credo von mir, dass man den Moment in der Musik noch heilig hält. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Moment auf Platte festzuhalten, man kann im Studio auch allesmögliche nachbearbeiten, aber irgendwann ist auch mal gut mit dem Perfektionismus. Die Platten, die wir lieben, ob James Brown oder Queen, die haben alle ihre Momente, wo das Mikroskop nicht scharf wird. Du kannst noch so genau hinschauen, du wirst nicht genau erkennen, was da passiert. Genau das sind aber die tollen Momente.
Heute kann jeder in kürzester Zeit am Computer einen House-Beat entwerfen. Braucht man für ein Groove-Verständnis trotzdem noch eine bestimmte Vorbildung?
Prommer: Theoretisch nicht. Wobei ich mich da mit einer Antwort schwer tue. Ich finde ja das Dilettantische oder Autodidaktische ganz toll, aber wenn man anfängt, das zu intellektualisieren und zur akademischen Kunstform zu erheben, wird es natürlich schwierig. Das würde ja zulassen, dass Ignoranz belohnt wird – und das geht natürlich nicht! (lacht)
Der Markt belohnt es manchmal.
Prommer: Genau, das ist ja auch ok. Prinzipiell ist Ignoranz nicht gut, aber wenn du einfach frisch und unbedarft an etwas rangehst und einfach machst, was dich begeistert und bewegt, dann ist das alles, was du brauchst. Wobei ein Vorwissen natürlich nie schädlich ist.
Ich finde es schon toll, dass heutzutage viele junge Leute mit ihrem Laptop und mit Ableton einfach loslegen. Die machen sich über Harmonie, Stimmung etc. keine Gedanken, sondern flicken einfach zusammen, was ihnen gefällt. Zum Teil kommen da tolle Sachen bei raus, zum Teil auch wahnsinnig viel Langeweile. Aber das war immer schon so, dass auch Leute Musik machen, die nichts zu sagen haben.
Ich sprach einmal mit DJ Koze darüber. Er mutmaßte, dass Dubstep durch „Nichtwissen und Naivität von irgendwelchen 19-Jährigen“ entstanden sein könnte, „die an ihren Plug-Ins rumschrauben“.
Prommer: Die ganze Musik, die uns gerade so begeistert, ist natürlich wahnsinnig technologiebasiert. Ich mache das jetzt seit den 90er Jahren. Und immer, wenn ein neuer Sampler rauskam oder ein neues Computerprogramm, hat sich was verändert. Das war immer ein revolutionärer Schritt. Auf einmal gab es Timestretching, oder Pitch-Correction, der Roland909 wurde erschwinglich, dann gab es Melodyne usw. Ich habe das auch alles immer gleich ausprobiert. Was Technik betrifft, kann ich wahnsinnig nerdig sein. Musikproduktion ist mittlerweile auch ein IT-Job geworden. Man verbringt viel Zeit vor dem Bildschirm, man guckt ständig auf den „Work in Progress“-Balken…
Und früher, die ganzen Techno-Klassiker, von Detroit bis Chicago, die sind auch alle entstanden, weil Technologie sich verändert hat. Das hatte immer mit diesem Fortschritt zu tun.
Könnte man sagen, deine Musik ist durch den technischen Fortschritt besser geworden?
Prommer: Ja, auf jeden Fall. Es gibt weniger Hindernisse auf dem Weg zur Idee, ich muss weniger Sachen bekämpfen oder klären. Wenn ich überlege, wie ich im Trüby Trio damals Remixe gemacht habe: allein, die Samples zu schneiden, um eine Idee ausprobieren zu können, das hat manchmal sechs Stunden gedauert – um dann zu sagen: Nee, ist doch nicht so gut. Jetzt dauert es eine halbe Minute, dann hast du das Sample im richtigen Tempo und kannst entscheiden, ob du damit weiterarbeitest. Das ist schon viel besser.
Es ist einfacher geworden.
Prommer: Ja. Man hat jetzt natürlich nicht mehr so viel Platz für lustige Fehler. Früher hast du manchmal auf dem Weg zur Idee noch etwas ganz anderes entdeckt. Dadurch, dass es jetzt schneller geht, sind diese Wege natürlich kürzer.
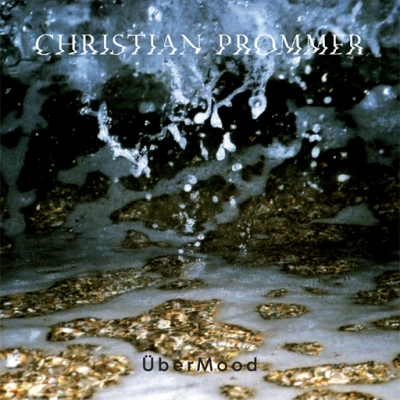 Ich habe gelesen, dass du schon seit vielen Jahren ein Solo-Album rausbringen wolltest, doch letztlich kam „ÜberMood“ erst 2014 raus.
Ich habe gelesen, dass du schon seit vielen Jahren ein Solo-Album rausbringen wolltest, doch letztlich kam „ÜberMood“ erst 2014 raus.
Prommer: Ich mache eigentlich immer Musik. Meistens kommt aber irgendwann jemand dazu und mit dem mache ich es dann fertig. So sind meine ganzen Projekte entstanden, Trüby Trio, Fauna Flash, Voom:Voom, Prommer & Barck. Vor zwei Jahren habe ich dann lange in Wien mit Kruder & Dorfmeister an einer Platte gearbeitet, die leider nie rauskam – und in der Zeit habe ich auch wahnsinnig viel Musik alleine gemacht, aus der dann schließlich mein Solo-Album geworden ist.
Du hast ja sehr häufig bei anderen Musikern als Produzent oder Arrangeur mitgemischt…
Prommer: Ja, oder mal was editiert – da gab es schon eine Menge. Ich versuche immer, offen zu bleiben. Und ich bin sehr leicht für etwas zu begeistern, was ein Vorteil, manchmal aber auch ein Nachteil sein kann. Meistens kommen aber gute Sachen dabei raus.
Haben all die verschiedenen Produktionen von dir eine Gemeinsamkeit?
Prommer: Das glaube ich schon. Sie haben meistens etwas Organisches, gemischt mit Elektronischem – und sie haben eine gewisse Freiheit. Ich wäre nicht bei einer Chart-Produktion dabei, wo es darum geht, glattgebügelten Teenie-Pop zu machen.
Wurdest du das mal gefragt?
Prommer: Ja, ich wurde schon ein paar Mal für kommerzielle Projekte gefragt. Aber dafür gibt es bessere Produzenten als mich.
Vermisst du das Organische heute in der elektronischen Musik?
Prommer: Nein, im Gegenteil, das ist besser geworden. Weil die Produzenten viel besser und die Produktionsmittel viel zugänglicher geworden sind.
„Organisch“ bedeutet für mich auch, dass das Menschliche drin ist, dass ein Track eben noch nicht so durchgestylt ist. Das gibt es heute schon viele tolle Sachen – man muss sich aber auch anstrengen, um die zu finden.
Bekommst du viel Musik zugeschickt?
Prommer: Ja. Ich freue mich auch über jeden, der mir Musik schickt, aber oft ist es nicht wirklich meins. Und die Leute werden auch immer dreister, das merkt man an der Ansprache, da steht dann in den E-Mails „Like my page and send me feedback“. Aber das ist auch ok, es ist halt eine andere Zeit. Ich weiß noch, wie nervös wir früher waren, wenn wir als kleine Newcomer Gilles Peterson eine CD mit unserer Musik überreicht haben.
Wie lange hast du in den 90ern gebraucht, um einen Track zu produzieren?
Prommer: Für die Frage bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich generell sehr lange brauche für meine Sachen. Die reine Arbeitszeit an so einem Track sind vielleicht zwei Tage, aber der liegt dann schon mal zwei, drei Wochen. Und das war früher genauso.
Zuerst ist der Track ganz voll und dann muss ich ihn entschlacken und vieles wieder wegräumen. Fertig ist er erst, wenn man nichts mehr wegnehmen kann.
Da bist du dann Perfektionist…
Prommer: Inhaltlich, ja. Was die Form anbelangt, weniger. Für ein Mastering bis in die letzte Mikrosekunde kann ich mich nicht begeistern. Die Energie brauche ich für was Anderes (lacht).

© PR
Stichwort Ableton: Wenn man möchte, schlägt einem das Programm ja alles mögliche vor: Rhythmen, Drums, sogar vollständige Akkorde…
Prommer: Natürlich. Wir leben in einer Preset-Zeit, wo du wahnsinnig viele vorgefertigte Sachen hast, die „Mr. Fingers“-Bassline ist schon fertig, du musst sie nur noch abfeuern – wenn du das willst.
Ich persönlich versuche, keine Presets zu benutzen, ich speichere auch nie was ab, ich fange immer wieder bei Null an.
Du hast für dich bestimmte Prinzipien?
Prommer: Genau. Ich mag das auch nicht, Sounds, die ich schon mal produziert habe, nochmal zu benutzen. Außerdem hat uns die elektronische Musik ja diese neue Ebene der Komposition in die Hand gegeben: Also nicht nur Rhythmik, Melodie und Harmonie, sondern auch die Ebene der Sound-Ästhetik. Der Klang ist jetzt eben auch eine Aussage, er hat eine Funktion, er besetzt einen Platz, den er aber auch besetzen soll.
Aber wie man damit umgeht muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch Leute, die mit Presets wahnsinnig tolle Musik machen. Ein Klavier klingt halt immer nach Klavier, du musst nicht jeden Sound neu erfinden. Nur, wenn wir dann über die kommerzielle Dance-Musik sprechen: da benutzen die Leute inzwischen ganze Logic-Arrangements, wechseln noch schnell die Melodie und die Bassline aus – und schon hast du den fertigen Track.
Spätestens seit „Sonnentanz“ von Klangkarussell wissen wir, dass man mit relativ wenigen Handgriffen auch einen Nr. 1-Hit machen kann.
Prommer: Ja, aber du musst auch die Idee dazu haben und du musst es machen.
Die Jungs zu kritisieren, weil sie es sich leicht gemacht haben, finde ich falsch. Die haben eben etwas gefunden, einen netten Track gemacht, und der ist dann abgegangen. Ich finde das völlig in Ordnung. Das ist ja auch eine Leistung, das so zusammenzubauen und dann so viele Leute damit glücklich zu machen. Die Sample-CD hat ja sich jeder kaufen können, die hat glaube ich 10 oder 12 Euro gekostet. Aber nur die beiden haben’s gemacht.
Gibt’s da manchmal Neid?
Prommer: Nein, Neid nicht, aber Respekt. So einen Stunt hinzulegen und dann so eine Karriere daraus zu machen, das ist schon cool.
Du hattest großen Erfolg mit der Drumlesson-Version des Clubtracks „Strings Of Life“ von Derrick May. Hast du später nochmal versucht, etwas zu produzieren, dass sich auf ähnliche Weise weiterverbreitet?
Prommer: Nein. Ich habe es vielleicht mal überlegt, manchmal denkt man sich: Was könnte ich denn noch machen mit diesem Tag? Aber an sich weiß ich, dass der Versuch, das zu wiederholen, der total der falsche Weg wäre. Du musst einfach gute Musik machen und das mit voller Begeisterung. Wenn du jetzt einen Hit planen willst, woran willst du dich da orientieren? Die Möglichkeit, zu scheitern, ist ja viel größer, als andersherum. Das sieht man jetzt an den den Leuten, die den Sound von Klangkarussell kopiert haben. Da ist viel Musik rausgekommen, die genauso klingt, aber dieser Erfolg ist natürlich nicht wiederholbar.
Da wird viel Geld investiert, in Videos, in Plakate – ich bin mir nicht so sicher, ob sich das lohnt. Und wenn es trotzdem mal funktionieren sollte – ja, dann ist das doch auch ok, mein Gott. (lacht)
In welchen Musikrichtungen willst du zukünftig noch experimentieren?
Prommer: Ich würde gern noch ein bisschen kammermusikalischer arbeiten und im Akustischen forschen. Damit meine ich jetzt nicht Jazz sondern eher die perkussive klassische Musik.
Wo die Bassdrum auch mal weg ist?
Prommer: Ja, wo der Puls durch etwas anderes entsteht. Auf „ÜberMood“ habe ist zum Beispiel das Stück „Marimba“ so konzipiert, das habe ich komplett auf einem Marimbaphon gespielt. Das war so ein Startschuss in diese Richtung.
Und ich träume davon, dass ich mal einen Orchesterprobenraum einen ganzen Tag für mich allein haben kann (lacht). Mit Mikrofonen, mit den Instrumenten, wo ich an allem rumspielen kann – ich muss mal bei der Musikhochschule fragen, ob das möglich ist.
Reizt dich auch ein klassischer Konzertsaal?
Prommer: Klar, das ist natürlich super interessant. Denn was wir im Club überhaupt nicht haben, ist Akustik. Aber so ein Konzertsaal klingt und der Raum macht etwas mit der Musik. Ich kenne das von den Drumlesson-Auftritten, wenn wir in Konzerthallen oder Kirchen spielen – da verändert sich etwas durch den Raumklang. Das gibt es im Club nicht, dort ist immer großer Druck und trockene Akustik.
Das gilt natürlich auch für die Plattenproduktion. Wenn du einen tollen Raum hast, in dem ein Instrument besonders klingt, dann musst du diesen Raum halt mit einbauen. Da gibt es noch viel zu entdecken.
Wer ist heute für dich ein wichtiger zeitgenössischer Komponist?
Prommer: Leute wie Kieran Hebden/Four Tet finde ich zum Beispiel sehr interessant. Der macht aber auch mehr so Skulpturen, nicht Songs im klassischen Sinn. Und Max Richter fällt mir noch ein. Ich habe neulich Filmmusik von ihm gehört, das klingt alles sehr interessant.
Du bist in Berlin in diesem Jahr beim „Xjazz-Festival“ aufgetreten, das Konzert lief unter dem Titel „Jazz Rave“. Siehst du dich mit deinen Produktionen als Jazz-Musiker?
Prommer: Ja, schon. Aber eher im Sinn der Haltung als beim Inhalt.
Wie meinst du das?
Prommer: Ich verstehe unter Jazz, dass man einfach offen ist und Kombinationen zulässt. Es muss nicht unbedingt ein Jazz-Standard gespielt werden, sondern man sagt: Komm, wir probieren etwas, was noch nicht da war. „Open-minded“ zu sein, das ist mir wichtig. Um das Virtuose im Jazz geht es mir weniger.
Könnte man denn sagen, Techno ist der ’neue‘ Jazz? Weil man im Techno heute Freiheiten hat wie im Jazz zu seiner Anfangszeit?
Prommer: Natürlich ist im Techno vieles offen, es ist mehr erlaubt, man kann mehr krasse Sachen ausprobieren. Aber Jazz wäre das falsche Wort dafür, weil es einfach schon so besetzt ist. Diese Bezeichnung ist nicht mehr frei.
Hättest du ein anderes Wort dafür?
Prommer: Nein, leider nicht. Ich sag immer, ich mache „Soulful Club Music“. Weil es für mich immer etwas Beseeltes haben muss.
